V.
„Was steht heute an, Manni?“, fragte Delamotte. Körperlich fühlte er sich so gut wie schon lange nicht mehr, ein paar Abende ohne Alkohol hatten wahre Wunder bewirkt. Obwohl er sich nach einem guten Glas Wein gesehnt hatte – oder gerne auch mehreren – war er auf Traubensaftschorle umgestiegen. Heute Abend, soviel war klar, würde er diesen Verzicht nicht mehr durchhalten. Aber immerhin hatte er eine kurze Zeit lang abstinent gelebt – zwar nach Ostern und beileibe keine vierzig Tage lang, aber immerhin.
Am Vortag hatten Lüttges und er bereits mit einigen engen Kontakten der ersten drei Opfer gesprochen. Aber weder die Lebensgefährtin von Sötenich noch dessen Mitarbeiter, weder die Führungskraft von Fischer noch die Mitarbeiter von Dorn hatten in irgendeiner Weise von Bedrohtheitsgefühlen der Betroffenen berichten können, noch hatten sie selber irgendwelche Beobachtungen gemacht.
Gleiches galt für Fischers letzten Kunden am Abend seines Todes, übrigens ein enger Freund des Nachbarn, der Fischers Leiche gefunden hatte.
„Das muss man sich vorstellen“, hatte der Mann gesagt, „gerade noch sitzt er bei mir im Wohnzimmer, wir reden über eine Lebensversicherung, und ein bisschen später findet Ismet ihn vor dem Haus – erschossen. Was für eine kranke Welt ist das?“
Lediglich zwei Parteifreunde Dorns, die an der Veranstaltung in Neringen teilgenommen hatten, vermeinten einen sich irgendwie verdächtig verhaltenden Mann auf dem Parkplatz gesehen zu haben. Diese Aussage hatten sie bereits im Vorjahr gemacht; eine brauchbare Beschreibung des Mannes hatten sie damals schon nicht machen können.
Manni bog in die Kaiserstraße ab. „Erst mal nach Vossem“, erklärte er, „zu Fischers Eltern.“
Delamotte verspürte einen Stich – es war das Gespräch, das ihm am meisten Unbehagen verursachte. Es erschien ihm unnatürlich, dass Eltern um ein Kind trauern mussten. Das widersprach dem normalen Lauf der Dinge, dachte er. Irgendwann im Leben trauerten Kinder um die Eltern; das ließ sich gar nicht vermeiden, die Biologie gab dies vor, und jeder Mensch musste sich innerlich auf den Moment vorbereiten, da Mutter oder Vater nur noch in seiner Erinnerung da waren.
Dies war nicht einfach, das wusste Delamotte nur zu gut; die Beerdigungen seiner beiden Großmütter hatte er noch genau in Erinnerung. Den Großvater mütterlicherseits hatte er nie kennengelernt, der war schon in den fünfziger Jahren an den Spätfolgen seiner Kriegsverletzungen gestorben. Opa Jacko würde irgendwann nicht mehr da sein, und das gleiche galt auch für seine Eltern. Delamotte kniff die Augen zusammen; er musste sich jetzt sammeln. Die Eltern Fischer hatten einen Verlust erlitten, den er sich nicht einmal vorstellen wollte.
Die erste von mehreren bewaldeten Anhöhen, die sich südlich von Vossem befanden, hatten die Leute seit Menschengedenken als „vörreschte Bärresch“ bezeichnet, als vordersten Berg. Die gebildeten Männer, die irgendwann im frühen 18. Jahrhundert in die Gegend gekommen waren, um sie zu kartographieren, hatten sicherlich viele Sprachen beherrscht, nicht jedoch den Dialekt der ansässigen Bauern. Und so war aus dem „vörreschte Bärresch“ der Fürstenberg geworden. An diesem Hang hatten dann im frühen 20. Jahrhundert die Besitzer der nahegelegenen Grube Victoria eine Siedlung für ihre Arbeiter angelegt. Die engen Straßen mit den kleinen Häusern erinnerten Delamotte an die Straßenzüge rund um den Vossemer Wall.
Lüttges fand einen Parkplatz vor einer kleinen Kapelle, die etwas oberhalb vom Haus der Fischers lag. Aufgrund des Vornamens hatte Delamotte zuerst vermutet, Silvio Fischer sei ein Zuwanderer aus Ostdeutschland gewesen. Und hätte er in den Unterlagen nicht den Geburtsort des jungen Mannes gesehen, dann wäre ihm spätestens nach den ersten Worten aus dem Mund von Fischers Mutter klargeworden, dass das zweite Opfer des Uhu aus der Region stammen musste.
Ein Vossemer Junge – war Fischer früher zum Eishockey gegangen? Hatte er dabei einen Grubenhelm getragen, wie es bei manchen Fanclubs aus den alten Bergmannsdörfern üblich war? Hatte er vielleicht sogar unweit Delamotte auf der Südtribüne gestanden, aus Leibeskräften „Bleesfelder Jonge“ singend? Es waren Fragen, die Delamotte sich selbst und den Eltern Fischer ersparte. Die Antworten hätten die Ermittlungen nicht weitergebracht, und wichtiger noch: die Fragen wären ein unangebrachtes Eindringen in das Leben des Opfers und seiner Familie gewesen.
Generell brachten die Aussagen der Eltern – die Aussagen der Mutter, um genau zu sein, Fischers Vater sagte kaum ein Wort – weder dem Psychologen noch dem Kommissar echten Erkenntnisgewinn.
„Der Silvio war so stolz auf seine eigene Agentur“, sagte die Frau, als sie Delamotte ein Foto ihres Sohnes in seinem Firmenwagen zeigte, „vorher hat er ja fast drei Jahre lang bei der Agentur Sümmermacher als Angestellter gearbeitet. Aber in Beyel, wo er sein eigener Herr war, da ist der Silvio richtig aufgeblüht.“
Delamotte fragte sich, ob er das Leben des ermordeten Versicherungsvertreters bislang in zu grauen Tönen gesehen hatte, oder ob die Mutter es in der Rückschau zu hell und farbig malte. Vielleicht traf beides zu, dachte er.
Er fuhr ziellos umher, und so langsam ermüdete ihn das. Wie schon an den Vortagen war das Tor der Tiefgarage kurz nach sieben Uhr hochgefahren, und der dunkelblaue Wagen italienischer Provenienz hatte sich auf den vergleichsweise kurzen Weg nach Adenkirchen gemacht. Dort war das Fahrzeug ebenfalls in einer Tiefgarage verschwunden; und in irgendeinem Büro des großen Gebäudekomplexes ging jetzt die Person mit dem vertraut klingenden Namen einer mehr oder weniger sinnhaften Tätigkeit nach.
An den beiden Vortagen hatte er sich die Mühe gemacht, in der Mittagszeit von einem kleinen Café aus den Eingang des Bürogebäudes zu beobachten. Aber das hatte nichts gebracht; entweder nahm die Zielperson Essen von zuhause mit, oder sie aß in einer Kantine. Also fuhr er ziellos umher – vor dem späten Nachmittag brauchte er nicht an der Ausfahrt der Tiefgarage zu stehen, in der das dunkelblaue Auto auf die Rückkehr seines Fahrers wartete. Eigentlich, überlegte er, könnte er in dieser Zeit auch einen Spaziergang machen, vielleicht an einem der Seen ganz in der Nähe, die früher wohl einmal Tagebaue gewesen waren. Mit einem Nicken setzte er den Blinker und bog ab.
Die Kanzlei Matthes lag in einem großen Bürokomplex im Westen der Stadt, in Adenkirchen, nur einen Steinwurf entfernt von der Ost-West-Magistrale. Sötenichs Exfrau hatte großen Wert auf die Unterstützung durch ihre Anwältin gelegt, schließlich hatte die Polizei sie bereits einmal unter Verdacht gehabt und wer konnte wissen, was die Beamten dieses Mal von ihr wollten. Lüttges hatte ihr zwar am Telefon versichert, dass sie nicht mehr unter Verdacht stand und lediglich noch mal als Zeugin befragt werden sollte, aber das hatte die Frau nicht überzeugt. Und so saßen der Kommissar und der Psychologe nun zwei sehr argwöhnischen Frauen gegenüber – es gab einfachere Situationen, musste Delamotte sich eingestehen.
„Wie ich Ihnen bereits gesagt habe, Frau Sötenich“, sprach Lüttges, „es geht hier nicht um die Vernehmung einer Verdächtigen, sondern um die Befragung einer Zeugin. Wir sind uns sicher, dass Sie nichts mit dem Tod Ihres Exmannes zu tun haben.“
Delamotte zuckte kurz zusammen – so eindeutig hatte Pesch die Mordserie am Karfreitag noch nicht gesehen, aber natürlich war seither einiges geschehen.
Lüttges fuhr fort: „Wir gehen davon aus, dass irgendwo da draußen der Mörder Ihres Exmannes frei herumläuft. Das wollen wir ändern. Dafür bitten wir Sie um Hilfe.“
„Glauben Sie denn, ich wollte das nicht?“, fragte Sötenichs Ex. Auf ihren Augen erschien ein feuchter Glanz, während sie fortfuhr: „Ja, das verdammte Arschloch hat mich verletzt wie ich es nie für möglich gehalten hätte. Aber wir hatten auch viele sehr gute Jahre zusammen, mein Mann und ich.“
Delamotte wartete einige Minuten, bevor er eingriff und die Frage stellte, die ihn am meisten interessierte: „Hat Ihr Exmann jemals erwähnt, dass er sich beobachtet oder gar bedroht fühlte?“
Die Frau überlegte kurz: „Nach der Trennung? Das kann ich nicht sagen, da müssen Sie seine Geliebte fragen. Wir haben dann ja nur noch über unsere Anwältinnen kommuniziert, mein Exmann und ich.“
Delamotte hakte nach: „Und vor der Trennung?“ Er glaubte zwar nicht, dass der Uhu seine Opfer so lange im Voraus beobachtet haben konnte – aber die Formulierung von Sötenichs Ex war ihm ungewöhnlich vorgekommen.
„Karlheinz selber hat das damals gar nicht ernstgenommen“, sagte die Frau, „aber ich hatte ein mulmiges Gefühl – das konnte doch kein Zufall sein, gleich dreimal oder viermal…“
Lüttges blickte auf: „Was ist denn da passiert, drei- oder viermal?“
„Das war, als Karlheinz den Führerschein abgeben musste, einen Monat lang. Manchmal habe ich ihn dann zu seinen Arbeitsstellen gefahren, wenn seine Mitarbeiter nicht konnten. Die Affäre mit dieser Frau hat er damals schon gehabt, nur ich hatte es noch nicht mitbekommen.“
Auch Jahre später, stellte Delamotte fest, war der Frau ihre Verbitterung anzumerken.
„Auf jeden Fall“, fuhr sie fort, „einmal brachte ich ihn zu einem Kunden in Altenstein, und direkt an der Ecke steht ein Auto und da sitzt ein Mann und ich denke mir: ‚Komisch, den hast du doch schon mal gesehen.‘ Und auf der Rückfahrt fiel mir ein, dass der gleiche Mann am Samstag davor an der Supermarktkasse hinter uns gestanden hatte. Und als wir dann gut eine Woche später essen waren, im Ramersfelder Hof, da taucht er wieder auf. Da habe ich dann Karlheinz auf ihn aufmerksam gemacht – aber der kannte ihn nicht und meinte, ich sähe Gespenster.“
„Und das vierte Mal?“, wollte Lüttges wissen.
„Da bin ich mir nicht sicher“, sagte die Frau, „ich glaube aber, ich habe das Auto des Mannes ein paar Tage danach mal hinter uns gesehen. Karlheinz hat nur gesagt: ‚Du spinnst!‘“
„Könnten Sie den Mann beschreiben?“, fragte Delamotte.
Manuela Sötenich blickte skeptisch: „Das hätte ich, glaube ich, damals schon nicht gekonnt. Aufgefallen ist mir eigentlich nur sein intensiver Blick.“
Delamotte fragte mit sanfter Stimme nach: „Jung oder alt? Groß oder klein? Dick oder dünn?“
„Ungefähr im Alter wie Karlheinz“, antwortete sie, „schlank, vielleicht Eins Achtzig groß, ziemlich unauffälliger Typ – mit Ausnahme der Augen eben.“
„Glaubst du, dass dieser unbekannte Mann wirklich der Uhu gewesen sein könnte?“, fragte Lüttges, während die beiden in einem Imbiss unweit des Bürokomplexes ein spätes, kleines Mittagessen einnahmen.
Delamotte, der gerade die restlichen kleinen Bruchstücke seiner Fritten auf die Gabel zu balancieren versuchte, zuckte mit den Schultern. Warum zum Teufel gab es eigentlich in Deutschland immer diese kleinen Bröckel, außer bei Madame Severine natürlich?
„Wann war dieses Fahrverbot von Sötenich genau?“, wollte er wissen.
„Herbst 1997“, antwortete Lüttges, ohne in den Unterlagen gucken zu müssen, „geblitzt worden ist er Anfang des Jahres. Deutlich schneller als erlaubt, mit einem Monat war er gut bedient.“
„Fast sechs Jahre vor dem Mord“, sagte Delamotte. Konnte es sein, dass der Täter derart langfristig plante? Vermutlich kaum, dachte der Psychologe, aber was wenn der Uhu schon viel früher Mordfantasien entwickelt hatte, als er bislang geglaubt hatte.
„Vielleicht war das mit diesem fremden Mann wirklich nur eine Kette zufälliger Begegnungen“, erwiderte er Lüttges, „obschon ich an solche Zufälle kaum glauben mag.“
Der große Parkplatz vor dem Ramersfelder Hof war bereits am Freitagnachmittag zur Hälfte belegt. Der Betreiber hatte den ehemaligen Gutshof bereits Anfang der achtziger Jahre in ein großes Ausflugslokal umgebaut. Auf die Besucher wartete ein umfangreiches Angebot an Gastronomie und Freizeit – ein Biergarten, ein Café, ein Grillrestaurant in der alten Scheune, das für gigantische Fleischportionen bekannt war, und eine Diskothek, die besonders bei den Altersgruppen Ü30 und Ü40 sehr beliebt war. Tagsüber fanden die Kinder der Besucher Ablenkung auf einem großen Spielplatz; und dann waren da noch die fünf Kegelbahnen, die Sötenich und seinen Freundeskreis in das Lokal geführt hatten.
Vor der Fahrt an den Parkgürtel hatten Lüttges und Delamotte sich in Dorns Anwesen mit Tanja Schröder getroffen, wie die ehemalige Miss Olympia mit bürgerlichem Namen hieß. Den Titel hatte die elegante Blondine sicherlich mit einigem Recht erhalten, wie Delamotte meinte. Aber es war nicht ihr Aussehen allein. Neben den Medaillen, die sie in ihrer aktiven Zeit gewonnen hatte, waren da noch die anderen Aktivitäten gewesen, die sie neben und vor allem nach dem Sport im Licht der Öffentlichkeit gehalten hatten. Schröder hatte gemodelt, einige Bücher geschrieben, sie moderierte eine ziemlich beliebte Fernsehshow und betrieb eine Schule für Coaching und Motivation.
Von daher hatte es Delamotte auch nicht überrascht, dass das große Haus schon zu Dorns Lebzeiten zur Hälfte ihr gehört hatte. Nun war sie die alleinige Eigentümerin, aber Delamotte hatte deutlich wahrgenommen, dass sie auf diesen Status gerne verzichtet hätte. Der Schmerz über den Verlust des Partners war ihr immer noch anzumerken.
Lüttges hatte auf dem Weg zum Ramersfelder Hof wohl seine Gedanken gelesen: „So umwerfend gut die Schröder ja aussieht – eine besonders glaubwürdige Zeugin ist sie nicht unbedingt.“
„Wie meinst du das“, hatte Delamotte verblüfft gefragt.
Lüttges hatte es ihm erklärt: „Na, sie hat doch mehrfach betont, sie habe Dorn regelmäßig zurechtgewiesen, wegen seines flotten Fahrstils. Nun gut – hast du den Sportwagen in der Einfahrt gesehen?“
Delamotte hatte genickt; so einen Maserati konnte man ja kaum übersehen.
„Das ist ihrer“, hatte Lüttges erzählt, „und die Dame sammelt mit ziemlicher Regelmäßigkeit Bußgeldbescheide ein – häufiger als Dorn, soweit mir das bekannt ist.“
Sötenichs Kegelbrüder saßen bereits an einem großen Tisch im Innenbereich des Biergartens. Lüttges kannte die meisten der Männer bereits; nachdem Delamotte sich gesetzt hatte, ließ er seinen Blick einmal über die Runde schweifen.
Was er sah, weckte Erinnerungen in ihm – er blickte in einfache, ehrliche, gute Gesichter. Solche Gesichter kannte er von den Morenhovens, besonders aber von den Delamottes. Und den Homolkas, und den Hofbauers. Diese Männer an dem großen Tisch, in ihren Vierzigern und Fünfzigern – sie erinnerten Delamotte an Familienfeiern am Vossemer Wall, Geburtstage mit kaltem Braten und Frikadellen und Kartoffelsalat und Schnittchen. Und der kleine Markus hatte zugehört, nicht so wie bei Onkel Jean, denn die Gespräche waren hin- und hergegangen, wild, unkoordiniert, für den kleinen Jungen kaum zu verfolgen.
Und jedes Mal hatte Anton Homolka, der Bruder seiner Oma, Ordnung in diesen wilden Haufen gebracht. Onkel Toni hatte ein Lied angestimmt, und alle hatten mitgesungen. Und Abende waren harmonisch zu Nächten geworden, mit „Hoch auf dem gelben Wagen“ und „Wem Gott will rechte Gunst erweisen“ oder auch „Wenn wir schreiten Seit an Seit“. Und ausgeklungen war es dann, wenn alle Platten und Schüsseln geleert und die Flaschen ausgetrunken und die Zigarren verglüht, und die kleineren Kinder meist schon in den Armen ihrer Mütter eingeschlafen waren, mit „Kein schöner Land in dieser Zeit“. Und ja, es hatte damals für ihn kein schöneres Land gegeben, oder vielleicht einfach keine schöneren Zeiten und keine schöneren Momente.
Lüttges blickte ihn fragend an; offenbar hatte er etwas gesagt und wartete auf eine Antwort. Delamotte musste sich zusammenreißen; warum verdammt war er heute so emotional? Lag das an seiner persönlichen Situation, oder an dem Fall? Oder fehlte ihm einfach der Alkohol?
Manni Lüttges stellte Delamotte abermals als den die Ermittlung begleitenden Psychologen vor. Die Männer am Tisch schauten ihn an, es lag ein wenig Distanz in ihren Blicken. Er sagte: „Wir haben guten Grund anzunehmen, dass dieser Mörder – der Uhu, wie ihn die Presse nennt – seine Opfer in den Tagen vor der Tat beobachtet, sie auskundschaftet.“
Einige der Männer wirkten angewidert.
Delamotte fuhr fort: „Hat Herr Sötenich vielleicht kurz vor dem Mord mal angedeutet, dass ihm jemand aufgefallen ist? Dass ihn jemand beobachtet oder verfolgt hat?“
Ein allgemeines Gemurmel setzte ein, einige der Männer nickten. Es dauerte einen Augenblick, bis ein etwas älterer Mann – ein Schreinermeister, wenn Delamotte sich recht erinnerte – die anderen mit einer Geste zum Verstummen brachte und ansetzte: „Das war aber schon mehrere Wochen vor der Tat, fast noch im Frühjahr.“
Ein anderer stimmte ihm zu: „Im Mai, ja, ich erinnere mich genau. Das war kurz vor der Hochzeit von Hacky und Irina.“
„Stimmt“, sagte ein graubärtiger Hüne, „deshalb war ich an dem Tag auch verspätet hier. Ich war mit dem Jungen noch bei Dievernich, um die Speisenfolge festzulegen.“
Lüttges griff ein: „Was genau ist damals passiert? Woran erinnern Sie sich?“
Der ältere Mann übernahm wieder: „Karlheinz war an dem Tag anders – sehr ruhig, etwas bedrückt. Das war gar nicht der Karlheinz den wir kannten. Jemand hat ihn gefragt, was mit ihm los ist.“
Er stockte kurz, suchte nach den genauen Worten. „‘Manuela hat mir einen Detektiv auf den Hals gehetzt‘, hat er gesagt“, fuhr der ältere Mann fort, „er hatte den Mann schon zweimal vor seinem Haus bemerkt, einmal im Supermarkt und einmal woanders.“
„Im Parkhaus der Airport Arena“, warf ein anderer ein.
„Stimmt, ich erinnere mich jetzt“, sagte der Schreiner, „und dann sagte Karlheinz, der Kerl stünde jetzt draußen auf dem Parkplatz. Erry hat ihn dann gefragt, warum Manuela denn einen Schnüffler auf ihn ansetzen sollte. Die beiden waren doch schon so lange geschieden. Und Karlheinz meinte nur: ‚Wer soll’s denn sonst sein?‘“
„Und dann ist Udo hier angekommen“, sagte ein schlaksiger Rotschopf, der einer der Jüngsten zu sein schien.
„Ja“, bestätigte der großgewachsene Graubart, „und Karlheinz hat mir das Ganze nochmal erzählt, und dann wollte ich mir diesen Kerl mal anschauen.“
Der ältere Schreiner erklärte: „Wir sind dann alle mit raus, Udo vorneweg, neben ihm Karlheinz. Aber der Typ war verschwunden, auf dem Parkplatz war er jedenfalls nicht.“
Viel mehr konnten Sötenichs Kegelbrüder nicht sagen; in den Wochen danach hatten sie noch das eine oder andere Mal über den Abend gesprochen, aber Sötenich hatte keine Andeutungen mehr gemacht und es war Gras über die Sache gewachsen.
Als Lüttges und Delamotte zum Parkplatz zurückgingen, folgte ihnen der Riese Udo. „Und? Erwischt Ihr den Kerl?“, wollte er wissen.
Lüttges antwortete: „Bei Mord ist der Aufklärungsquote ziemlich hoch.“
„Auch bei so einem?“, fragte Udo. „Kann man sowas überhaupt lernen?“
Delamotte fühlte, dass die Frage primär an ihn gerichtet war. Er antwortete langsam: „Es gibt Dinge, die lernt man und hofft, dass man sie nie braucht. Und dann braucht man sie doch, und man setzt sie ein und hofft, dass man das Gelernte gut und präzise umsetzen kann.“
Udo überlegte eine Weile: „Wir sind heute erst das zweite Mal hier, seitdem Karlheinz nicht mehr da ist. Alles hat sich geändert. Zum Kegeln treffen wir uns jetzt beim Dedrichs in Heppel. Hier? Unmöglich. Alles ist jetzt anders.“
Delamotte erwähnte: „Heute früh waren wir bei den Eltern des zweiten Opfers.“
Udo nickte verständnisvoll: „Der von der Versicherung. Eltern sollten nie den Tod eines Kindes erleben.“ Er stockte kurz: „Ihr Jungs habt wirklich nicht den einfachsten Job.“
„Welcher Job ist schon einfach?“, fragte Delamotte und nickte dem Mann zum Abschied zu.
Verärgert, fast schon wütend startete er den Motor. Jetzt noch zu warten, machte keinen Sinn. Dafür hatte er die Zielperson bereits zu gut kennen gelernt. Er würde morgen früh wiederkommen, vielleicht hinter der Hecke parken, von dort aus konnte er die Garagenausfahrt gut beobachten, ohne unerwünschte Aufmerksamkeit zu wecken. Vielleicht ergab sich ja an einem Samstag eine Gelegenheit.
Wochentage waren jedenfalls nicht geeignet, so viel war ihm inzwischen klar. Dieser Mann, den er beobachtete: er fuhr morgens ins Büro, arbeitete recht lange, und fuhr dann wieder nachhause. Und da blieb er dann, in seiner Wohnung. Kein Spaziergang, kein Restaurantbesuch. Kein Treffen mit Freunden, kein Joggen, kein Garnichts. Was für ein Langweiler!
Gut, am Vortag war der Kerl nach der Arbeit nicht direkt nachhause gefahren. Er hatte einen Fitnessklub aufgesucht. Durch die Fensterfront hatte er den Typen sogar beobachten können. Crosstrainer, Stepper, ein paar Worte mit einer jungen Frau. Na wenigstens etwas… Dann noch eine Dreiviertelstunde auf dem Laufband, bevor er vermutlich geduscht hatte. Den Club verlassen hatte er dann nicht alleine, sondern in Begleitung eines Paares mittleren Alters.
Fast schon war er geneigt, diesen Fall aufzugeben und die andere Karte wieder aus dem Kasten zu holen. Der altmodische Impuls hielt ihn davon ab. Und er war ja erst seit kurzem an diesem Fall dran, und die eine oder andere Chance musste er diesem Mann ja noch geben.
Als Delamotte nach dem Duschen aus dem Badezimmer kam, erfüllte der betörende Duft aus der Küche bereits die ganze Wohnung. Schon am Vorabend hatte er den Rinderbraten in einem Sud aus Rotwein, Zwiebeln, Knoblauch, Piment, Chili und Fenchelsamen eingelegt. Vorsichtig nahm er nun den Bräter aus dem Backofen, um das Fleisch zu wenden, das begleitet von Möhren, Sellerie und Lauch langsam bei mittlerer Hitze schmorte. Dann goss er sich einen kleinen Schluck des Côte Rôtie ein, den er nach der Heimkehr in eine Karaffe gefüllt hatte und der seinen Gaumen genauso betören würde wie der Duft des Bratens seine Nase. Delamotte stellte das nicht einmal zur Hälfte gefüllte Glas auf dem Schreibtisch im Arbeitszimmer ab, um sich im Schlafzimmer anzuziehen.
Bereits bei den Essensvorbereitungen waren ihm diverse Gedanken durch den Kopf gegangen. Konnte es sein, dass Manuela Sötenich ihren Ex-Mann hatte überwachen lassen? Er hatte die Frau kennengelernt, hatte – auch Jahre nach der Scheidung – deutlich gespürt, welche seelischen Verletzungen der Mann bei seiner Gattin ausgelöst hatte. Von daher: er hielt das durchaus für möglich. In dem Fall musste Frau Sötenich wohl einen ziemlichen Anfänger auf ihren Ex angesetzt haben. Soweit er das beurteilen konnte, war Karlheinz Sötenich kein besonders aufmerksamer Beobachter seiner Umgebung gewesen. Den fremden Mann, der seiner Frau noch vor der Trennung aufgefallen war, hatte er nie bemerkt. Einen wirklich professionellen Privatdetektiv hätte Sötenich wohl kaum wahrgenommen. Und, die Schlussfolgerung lag für Delamotte auf der Hand, auch den Uhu nicht. Nein. Der Mann, den sich Udo und die anderen Kegelbrüder hatten vornehmen wollen, war höchstwahrscheinlich nicht der spätere Mörder ihres Kumpels gewesen.
Delamotte setzte sich an den Schreibtisch und steckte seine Nase in das Weinglas. Er nahm den intensiven Duft des reifen Syrah auf, seufzte zufrieden und ließ einen Schluck des Weins seine Geschmacksnerven reizen. Ja, das hatte er die letzten Abende vermisst. Er zwang sich dazu, seine Gedanken wieder dem Fall zuzuwenden. Besonders dem Vorkommnis, das Manuela Sötenich so eindringlich geschildert hatte. Dieser fremde Mann, der mehrmals den Weg der Sötenichs gekreuzt hatte – an der Supermarktkasse, an einem Einsatzort ihres Mannes, im Restaurant. Und eventuell noch auf der Straße. Kurz nach Sötenichs Fahrverbot – das könnte passen zu jemandem, der Zugriff auf die Daten der Verkehrspolizei hatte. Aber sechs Jahre vor dem eigentlichen Mord?
Hast du dein späteres Opfer wirklich schon Jahre vor der Tat beobachtet? Nicht, dass ich dir das nicht zutrauen würde. Aber falls ja: der Vorbereitung der Tat kann das nicht gedient haben. Oder war das damals auch noch gar nicht dein Ziel? Du hattest dir die Daten von Sötenich beschafft, woher auch immer. Du hattest sie parat, wie auch die Daten von Fischer, von Dorn, und wer weiß von wem noch alles. Und ich glaube, du hast damals schon mit dem Gedanken gespielt, zu töten. Aber getraut hast du dich noch nicht. Du hast einen Teil deiner Zeit genutzt, um zumindest Sötenich mal zu beobachten. Nur Sötenich? Und was hat es dir gebracht? War das alles ein Ventil, um Dampf abzulassen? Und irgendwann hat dann dieses Dampf ablassen nicht mehr gereicht, und du musstest weiter gehen, oder was?
Delamotte stand auf – es gab noch einiges zu tun. Doch während er die Küche aufräumte und den Tisch im Wohnzimmer für zwei Personen eindeckte, kam in ihm deutlicher als vorher die Frage hoch, die ihn erschrak: wie viele potentielle Opfer hatte der Uhu noch auf seiner Liste?
Diesen Gedanken versuchte Delamotte soweit dies möglich war zu verdrängen. Er lenkte seine Aufmerksamkeit auf sich selbst; zweimal hatte er sich an diesem Tag nicht wirklich unter Kontrolle gehabt. Dass ihm das Schicksal der Eltern Fischers naheging, war verständlich, aber in der Ausprägung an diesem Vormittag nicht wirklich professionell. Mehr noch beunruhigte ihn sein emotionaler Flashback im Ramersfelder Hof. Generell kam es ihm so vor, als wäre er in jüngster Zeit besonders schwach und verwundbar. Nagte das Ende mit Sonja doch immer noch an ihm? Oder war es vielleicht eher so, dass er sich gerade jetzt, wo er das Ende der Beziehung akzeptiert hatte, der Welt wieder öffnete? Zu weit öffnete, vielleicht?
Es klingelte. Delamotte würde seinen Gast um Rat bitten. Wenn er es objektiv betrachtete, war Ali ein weitaus besserer Psychologe als er selber.
Sie hatten einen einfachen, aber leckeren Cabernet Franc in den Gläsern, und jeder der beiden hatte vor sich ein Gläschen von dem libanesischen Arak, den Ali mitgebracht hatte. Das Essen hatte wie erwartet gut geschmeckt, sie hatten viel zu bereden und Delamotte erzählte Ali von dem indischen Gewürzgeschäft, das er vor Jahren entdeckt hatte, und von dem die Chilis im Essen stammten. Der Laden lag auf der äußeren Straßenseite des Boulevards, die bereits zum Stadtbezirk Galgenwardt gehörte.
„Ich bin bei einem Spaziergang da vorbeigekommen, reiner Zufall also“, sagte er, „und drinnen empfing mich ein unglaublich toller Duft von den unterschiedlichsten Gewürzen. Und die Preise waren deutlich günstiger als in Supermärkten. Ich habe dann so eine Art Großeinkauf daraus gemacht, unter anderem auch einen großen Beutel von den Chilis gekauft. Der indische Inhaber warnte mich, die Dinger seien sehr scharf. Ich habe ihm nur gesagt, dass wir es scharf mögen.“
Ali lächelte; ihm gefiel es besonders, dass Delamottes so selbstverständlich von seiner Zeit in der Altstadt erzählte. Das war ein gutes Zeichen.
Delamotte fuhr fort: „Und ein paar Tage später erwähnte meine Mutter am Telefon, sie brauche dringend getrocknete scharfe Chilis. Also ging ich wieder nach Galgenwardt und schnappte mir noch so einen großen Beutel. Der Händler blickte mich entsetzt an: ‚Haben Sie etwa den ersten Beutel schon verbraucht?‘“
Beide Männer lachten, und Ali sagte: „Es ist sehr gut, mein Freund, dass du wieder so locker von Dingen erzählen kannst, die zeitlich und örtlich irgendwie mit deiner jüngeren Vergangenheit zu tun haben.“
Delamotte stimmte seinem Freund zu, er sah das ganz ähnlich.
Ali hob das Glas, und die beiden stießen mit Arak an. Dann wurde Ali ernster: „Was du während des Essens erzählt hast, hat mir zum Teil nicht so gut gefallen.“
Delamotte hatte von Beginn an gewusst, dass so etwas kommen würde.
Sein alter Freund hob mahnend den Finger: „Es ist nicht einmal der Umstand, dass dir das Schicksal der Opfer und ihrer Familien und Freunde so nahegeht. Das ist menschlich – auch wenn du diese persönliche Anteilnahme etwas reduzieren solltest. Aber darüber reden wir später.“
Fast kam es Delamotte so vor, als spräche er mit seinem Beichtvater.
„Du hast durchaus Recht mit deiner Vermutung, dass du dich ein wenig zu weit öffnest“, fuhr Ali fort. „Dass du dies deiner neuen Nachbarin gegenüber so hältst, ist dabei das geringste Problem“, sagte er, „ganz im Gegenteil.“
Delamotte unterbrach ihn sanft: „Ich habe dir aber auch gesagt, dass ich es nicht auf eine neue Beziehung anlegen will, also von der Warte aus…“
Ali unterbrach ihn seinerseits: „Ich wollte auch nichts in dieser Hinsicht andeuten. Aber es ist in deiner Situation gut, einen vertrauensvollen Bezug zu jemandem zu haben, der gleich nebenan wohnt. Und deinen Schilderungen habe ich entnommen, dass dies mit Britta der Fall sein könnte.“
Ali holte tief Luft, bevor er weitersprach: „Anders sieht das mit deinen Kollegen aus. Ein wenig sogar mit Claudio.“
Delamotte wollte etwas sagen, aber Ali hob fast schon gebieterisch die Hand: „Ich weiß, was du sagen willst – ja, Claudio ist ein Freund, er ist ein prima Typ. Aber er ist eben auch ein Kollege. Das kann zu Komplikationen führen. Behalte das im Blick!“
Der Libanese wartete einen Moment, damit Delamotte die Aussage verdauen konnte. „Das gilt natürlich erst recht für die anderen Kollegen – und ganz besonders für Pesch“, sagte er.
„Er ist viel freundlicher in den letzten Tagen, viel persönlicher, sogar verletzlich wirkt er auf mich“, warf Delamotte ein.
Ali schüttelte den Kopf, die Naivität seines Freundes war ihm bisweilen ein Rätsel: „Natürlich ist er freundlich zu dir. Er braucht dich! Schau mal, er ist seit Monaten an diesem Fall dran, fischt im Trüben, ist dem Täter keinen Zentimeter nähergekommen. Du bist seine letzte Karte. In erster Linie bist du da, um die Karriere von Hauptkommissar Pesch zu retten.“
Delamotte verdrehte leicht die Augen.
„Ja, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben“, gab Ali zu, „aber eben nur ein bisschen. Und ganz klar, solange dieser Killer da draußen frei rumläuft, ist Pesch verletzlich. Und du hast gerade aufgrund deiner eigenen Situation ein besonderes Gespür für Verletzlichkeit. Ob Pesch umgekehrt das gleiche Gespür hat? Du kennst ihn besser…“
Ja, das war eine verdammt gute Frage, dachte Delamotte.
„Und was das Persönliche angeht, “ erklärte Ali, „unter Einfluss von Alkohol sind wir alle persönlicher. Und bei manchen Leuten bringt der Alkohol die schlechten Seiten zum Vorschein, und bei anderen die guten. Pesch, will mir scheinen, gehört zu der zweiten Gruppe. Aber ohne Alkohol und ohne feuchtfröhliche Runden könnte er auch ganz schnell wieder der alte Pesch sein.“
Delamotte leerte sein Glas, er brauchte den Schluck nach dieser Kopfwäsche. Und verdammt, Ali hatte ja Recht.
„Und was meintest du damit, dass ich meine Anteilnahme reduzieren sollte?“, fragte er.
Ali goss beiden etwas Arak und Eiswasser nach, bevor er den Punkt erklärte: „Markus, es ist vollkommen natürlich, Mitgefühl zu haben. Emotionen sind Teil unserer Natur. Aber Emotionen sind auch wie Radiowellen – sie können sich überlappen und gegenseitig stören.“
Das Bild war beeindruckend, dachte Delamotte.
„Wenn du zu sehr mit den Opfern beschäftigt bist – oder auch mit dir selber, denn so richtig überwunden hast du die Vergangenheit noch nicht, denke ich – wenn bei dir also Emotionen aus allen Richtungen ankommen, dann stört das die Empfangsbereitschaft deiner Antennen für das, was jetzt gerade am wichtigsten ist: die Gefühlswelt dieses Mörders, den du jagst. Für dessen Emotionen musst du jetzt aufnahmebereit sein, damit kommst du ihm näher. Das ist dein Ding. Das ist deine Stärke. Und nebenbei bemerkt, das ist es, was Pesch von dir erwartet. Und das sogar zu Recht.“
Delamotte nickte, sein alter Freund hatte da einiges klargestellt, das ihm selbst bisher entgangen war.
„Und damit ist die Predigt beendet“, sagte Ali und lächelte.
„Amen“, sagte Delamotte und hob sein Glas.
In den Tagen danach sollte Delamotte oft an Alis Predigt denken. Sein alter Freund hatte, wie schon so oft, die Dinge viel besser durchschaut als er selber. Der neue Spirit, den er laut Pesch ja angeblich ins Ermittlungsteam gebracht hatte, war verdammt schnell verflogen – sofern es ihn denn überhaupt jemals gegeben hatte.
Und bei niemandem war dies deutlicher zu spüren als bei Pesch selber. Er war wieder der alte Hauptkommissar Pesch, drängelnd, ungeduldig, jederzeit bereit, den Druck, unter dem er sicherlich stand, weiterzugeben.
Und niemand bekam das deutlicher zu spüren als Delamotte; oft schien ihm, Pesch erwarte weniger eine fundierte psychologische Analyse der Taten als vielmehr irgendeinen Voodoo-Zauber, der möglichst rasch zu einer Lösung des Falls führen würde.
Es machte die Sache nicht leichter, dass auch die Kollegen mit ihren Ermittlungsansätzen nicht recht weiterkamen. Mit Lüttges funktionierte die Zusammenarbeit auf einer professionellen Ebene recht gut, und auch persönlich kamen sie hinlänglich miteinander klar. Claudio arbeitete sich in den Fall ein, stellte meistens die richtigen Fragen – Delamotte war froh, seinen Kumpel mit im Team zu haben. Maas und Henseler dagegen hielten sich zumeist bedeckt; er konnte sie gut verstehen, die Aufgaben, die Pesch den beiden zugewiesen hatte, waren undankbar. Und Delamotte glaubte nicht, dass irgendein substantieller Erkenntnisgewinn aus ihrer Arbeit zu ziehen war. Nein, der Uhu war seiner Einschätzung nach noch nie mit Polizei und Justiz in Konflikt geraten.
Dass seine Eltern weiterhin bei jeder Gelegenheit versuchten, den verlorenen Sohn wieder in die Wiesenau zu locken – sie hatten sogar angedeutet, das Haus, in dem er und seine Geschwister großgeworden waren, vielleicht zu verkaufen – nun, auch das machte seine Lage nicht unbedingt angenehmer.
Wenigstens Opa Jacko hatte ihn ein wenig aufgemuntert, hatte ihn angerufen nach einem Bericht über den Fall im Regionalfernsehen, in dem – wer sonst? – natürlich Pesch mal wieder vor die Kamera getreten war.
Und Britta hatte ihm eine kleine Notiz zukommen lassen, auf einem Post-It an der Wohnungstüre. Sie besuchte zusammen mit Timmy ihre Eltern, ein paar Tage lang. „Nur falls du uns vermisst“, wie sie geschrieben hatte. Gefolgt von einem Smiley. Das hatte Delamotte berührt.
Der Ring - Fortsetzungsroman, Teil 8
-
„Okay, Alter, wer schlägt auf?“ Marino grinste, seine grünen Augen leuchteten noch heller als gewöhn…
-
20 Jan 2024
Der Ring - Fortsetzungsroman, Teil 6
-
IV.
Der Kaffee war deutlich stärker als gewohnt, und damit genau das, was Delamotte brauchte. Der…
-
18 Jan 2024
See all articles...
Authorizations, license
-
Visible by: Everyone (public). -
All rights reserved
-
21 visits
Jump to top
RSS feed- Latest comments - Subscribe to the feed of comments related to this post
- ipernity © 2007-2024
- Help & Contact
|
Club news
|
About ipernity
|
History |
ipernity Club & Prices |
Guide of good conduct
Donate | Group guidelines | Privacy policy | Terms of use | Statutes | In memoria -
Facebook
Twitter
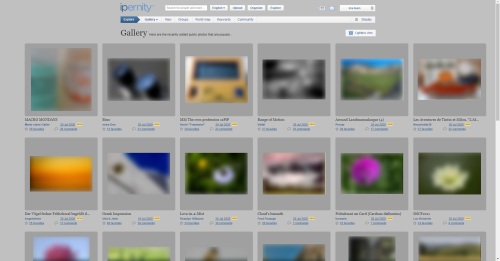
Sign-in to write a comment.