III.
Delamotte räumte den Küchentisch ab und machte sich noch einen weiteren Milchkaffee. Der Wecker hatte ihn um sieben Uhr aus einem kurzen, unruhigen Schlaf gerissen. Nach dem Duschen und einem Spaziergang zur Bäckerei hatte er ausgiebig gefrühstückt – ein guter Start in diesen Tag war ihm wichtig, und unter anderen Umständen wäre er jetzt ja eh noch im Hotel gewesen. Er nahm den Kaffee mit ins Arbeitszimmer und wühlte sich durch die Mappen der vier Mordfälle.
Drei Stunden später hatte er zwar viele Informationen aufgenommen und neu sortiert, aber es kam ihm nicht so vor, als ob er dem Täter dadurch viel näher gekommen wäre. Der Uhu war schon ein besonderer Fall. Während seiner Studienzeit in Amerika hatte sich Delamotte intensiv mit Serientätern beschäftigt. Aber das meiste von dem, was er dort gelernt hatte, schien hier nicht zu greifen. Er sah an den Taten keinerlei sexuelle oder fetischistische Komponente – der Uhu wollte einfach töten, mehr nicht. Aber warum?
Es macht dich nicht wirklich an, nicht wahr? Du verfolgst dein Opfer, oder lauerst ihm auf oder auch beides. Und dann? Du ziehst deine Waffe, du schießt, du triffst. Ich glaube, du schaust dir dein Werk danach nicht einmal an – du gehst einfach weg. Was bringt dir das?
Hatte der Täter schon früher gemordet? Manches sprach dafür – die vergleichsweise abgebrühte Vorgehensweise, die kurzen Intervalle zwischen den drei Morden vom Vorjahr. Unabhängig von dieser Frage: der Uhu hatte mit einiger Sicherheit schon lange vorher vom Töten geträumt. Woher kamen diese Träume? Die drei Morde vom Vorjahr musste er vorbereitet haben. Bei dem Arzt war das anders. Und falls er nicht beruflich mit Handfeuerwaffen vertraut war, hatte der Täter irgendwann schießen lernen müssen. Von den Ermittlern wusste Delamotte, dass es einiges an Übung erforderte, regelmäßiger Übung, um zielsicher auf bewegliche Ziele schießen zu können. Wo hatte der Uhu das gelernt?
Du hast dich lange darauf vorbereitet – sehr lange sogar. Und du hast ein immer gleiches Szenario im Kopf, mit einem passenden Opfer und passenden Umständen. Ja, ich weiß auch, was für dich die passenden Umstände sind – gute Chancen, dass dich niemand dabei beobachten kann. Das machst du auch ganz ordentlich, das muss ich zugeben, aber ein Profi bist du nicht. Zumindest noch nicht. Bei dem Versicherungsvertreter bist du aus dem Schatten des Fußwegs ins helle Licht der Straße getreten. Warum eigentlich? Ist dein Timing durcheinander gekommen? Hat es etwas mit diesem ominösen Hustenbonbon zu tun? Wie dem auch sei: du willst nicht beobachtet werden. - Falsch! Das ist zweitrangig. Wenn dich keiner beobachtet, kann dich keiner beschreiben. Und man kann dich nicht identifizieren – und nicht erwischen. Das ist es, nicht wahr? Du willst damit nicht aufhören. Warum? Dass du Befriedigung aus dem Töten ziehst, glaube ich nicht – im Leben nicht… Was treibt dich also an? Und was machte diese vier Männer zu passenden Opfern?
Auffallende Gemeinsamkeiten sah Delamotte bei den Opfern nicht. Sie gehörten verschiedenen Altersgruppen an, arbeiteten in unterschiedlichen Berufen, auch bei den privaten Lebensverhältnissen fand sich, wie Lüttges bereits angemerkt hatte, fast die komplette Bandbreite. Auch der jeweilige Sozialstatus der vier Männer war sehr verschieden. Nur Dorn hatte im Licht der Öffentlichkeit gestanden, durch seine politischen Aktivitäten und seine Beteiligung an diesem russischen Immobiliendeal. Die anderen drei? Weitgehend unauffällig.
Delamotte klammerte das letzte Opfer aus. Sötenich, Fischer, Dorn: alle drei waren selbständig gewesen, in Berufen, die viele soziale Kontakte mit sich brachten. Konnte es jemanden geben, der mit allen dreien in Kontakt gestanden hatte? Hatte der Uhu über Dorn eine Wohnung gekauft, die Sötenich dann neu gestrichen hatte? Und hatte er dann bei Fischer eine neue Hausratversicherung abgeschlossen? Und, möglicherweise Jahre später, alle drei erschossen? Delamotte schüttelte den Kopf – das war viel zu unwahrscheinlich.
Er erinnerte sich an einen Rat, den Ray Greene seinen Studenten gegeben hatte: „Konzentriert euch auf das erste Opfer.“ Sötenich also – wenn er denn tatsächlich das erste Opfer war. War Sötenich für den Uhu ein besonders naheliegendes Opfer gewesen? Delamotte notierte sich diesen Gedanken auf einem Post-it und klebte diesen auf das Whiteboard zu den anderen, aber ganz nach oben. Dann wandte er sich verstärkt dem Chirurgen zu.
Der Mord an Dr. Ernsting, da war er mit Lüttges völlig d’accord, wirkte in dieser Sammlung wie ein Fremdkörper. Alles an diesem Ablauf sprach gegen eine geplante Tat. Der Uhu konnte nicht wissen, dass sich das Opfer zur Tatzeit am Tatort aufhalten würde. Überhaupt der Tatort: ja, es war dunkel, aber auf dem Parkplatz eines nicht gerade kleinen Krankenhauses konnte jederzeit jemand vorbeikommen. Das passte nicht zu der Achtsamkeit, die der Uhu bei den vorherigen Morden gezeigt hatte.
Lass uns mal über den Chirurgen reden – den hattest du bis kurz vor der Tat gar nicht auf dem Schirm, stimmt’s? Den hast du ganz spontan erledigt, nicht wahr? Wo ist er dir aufgefallen? Direkt vor dem Krankenhaus? Das denke ich nicht. Warum hättest du dort sein sollen? Als Patient vielleicht? Nein, das ist unwahrscheinlich. Was macht ein Patient um diese Zeit auf dem Parkplatz? Und noch dazu bewaffnet? Und einen Patienten besuchen konntest du um diese Uhrzeit auch nicht. Du bist auf ihn aufmerksam geworden, als er auf dem Weg zum Krankenhaus war, oder nicht? Aber was hatte er an sich, das in dir den Mordtrieb ausgelöst hat? Oder war das gar nicht der Arzt? - Er hieß übrigens Dr. Richard Ernsting und hinterlässt eine Frau und drei kleine Kinder. Lässt dich das etwa kalt?
Delamotte musste seinen Gedankenstrom bremsen, er ging die Sache gerade zu emotional an. Aber der Gedanke hatte etwas für sich: konnte es sein, dass etwas völlig anderes den Täter derart stark bewegt hatte, dass er die erste Person, die ihm irgendwie auffiel, töten musste? Delamotte war sich nicht sicher, auch das passte eigentlich nicht zum sorgsamen Vorgehen des Uhu in den vorherigen Fällen. Er hatte jedoch eine Ahnung: wenn sich im Fall Ernsting ein denkbares Motiv fände, könnte das auch auf die anderen Fälle anwendbar sein.
Die Klingel riss Delamotte aus seinen Überlegungen. Sein erster Verdacht fiel auf Britta Kowallik, aber vor seiner Wohnungstür stand niemand. Er ging zur Gegensprechanlage – die Kamera im Hauseingang zeigte ein wohlbekanntes Gesicht, und er betätigte wortlos den Türöffner, denn der Besucher wusste genau, dass Delamotte im vierten Stock wohnte.
Marino erschien wenige Augenblicke später im Korridor. „Hast du Zeit?“, fragte er.
Delamotte bejahte, wunderte sich aber, was Claudio Marino an einem Samstag um diese Uhrzeit von ihm wollte.
„Na, morgen wäre es zu spät“, sagte Marino lächelnd.
„Zu spät wofür?“, fragte Delamotte.
Marino grinste: „Um ein Geschenk für Pesch zu kaufen, oder willst du morgen nach Belgien fahren, um ihm Kirschbier, Blutwurst oder diesen schrecklichen Käse zu besorgen?“
„Der Käse ist nicht schrecklich, nur ein wenig intensiv. Und außerdem verletzt du gerade meine wallonische Seele. Stell dir vor, ich würde mich in dieser Form über Scamorza äußern“, erwiderte Delamotte und drohte seinem Freund scherzhaft mit dem Finger.
„Das ist ja wohl ein sehr gewagter Vergleich“, lachte Marino, „und ein wenig intensiv ist die Untertreibung des Jahres.“
„Schlimmer als dieser sizilianische Madenkäse kann er jedenfalls nicht sein“, widersprach Delamotte.
„Der hat keine Maden, sondern Fliegenlarven“, korrigierte Marino, „und außerdem ist er aus Sardinien. Damit bin ich als Sizilianer außen vor.“
„Halbsizilianer“, sagte Delamotte, „deine Mutter stammt doch aus den Abruzzen, oder?“
Marino nickte: „Damit bin ich aber immer noch mehr Sizilianer als du Wallone. Das war dein Uropa. Und was steckt sonst noch in dir? Polen, Bayern, und eine Menge Gene von den Bauern dieser Region hier, die man ja manchmal als nördlichste Ecke des Bel Paese meiner Vorfahren bezeichnet.“
„Nun, dann sind wir ja fast schon Blutsverwandte“, lachte Delamotte, „und was für eine Geschenkidee hast du für den lieben Kollegen?“
„Ach, auf einmal ist er ein lieber Kollege? Vor knapp einer Woche war er noch ein Beamtenarsch“, erinnerte Marino seinen Kumpel an das Gespräch bei dessen Wohnungseinweihung.
Delamotte gab die Antwort in gesungener Form: „The times they are a-changing.“
„Von der Grundidee her passt’s“, prustete Marino.
Wenig später saßen sie in Marinos schon etwas in die Jahre gekommenen BMW und fuhren über die Nord-Süd-Magistrale Richtung Innenstadt. Das Wetter war herrlich, die Temperaturen waren seit Gründonnerstag beharrlich gestiegen, ein Hauch von Frühsommer lag in der Luft. Marino hatte seine Lederjacke auf den Rücksitz des Wagens geworfen, Delamotte hatte sein Sakko mit der gleichen Nachlässigkeit behandelt.
„Es gibt da diesen Laden in Attika“, erzählte Marino, „die sind spezialisiert auf eher seltene Schallplatten. Da finden wir bestimmt was Passendes für Pesch.“
„Woher weißt du denn, welche Platten ihm in seiner Sammlung fehlen?“, fragte Delamotte.
Sein Kumpel klärte ihn auf: im Vorjahr hatte Marino sich Peschs Sammlung genauer angeguckt. Dabei war ihn aufgefallen, dass ihre Musikgeschmäcker eine gewisse Schnittmenge aufwiesen. Und bei einer besonderen Band aus England hatte er einige Lücken in Peschs Bestand entdeckt. „Wenn er in den letzten 12 Monaten nicht einiges von The Fall gekauft hat, haben wir gute Chancen“, sagte er.
Delamotte hatte mit dieser Art Musik wenig am Hut; aber der Ehrlichkeit halber musste er sich eingestehen, dass er ohne Marino vergessen hätte, Pesch ein Geschenk zu besorgen.
Zwischen Reven und Lantzen unterquerte die Magistrale den Parkgürtel. Dem Bau der beiden jeweils vierspurigen Magistralen waren in den sechziger Jahren einige Gebäude zum Opfer gefallen – lediglich in den engeren Kernen von Alt- und Neu-Marßen hatten sich die Stadtoberen zur Tunnellösung entschieden. Als dann aber, nach der großen Stadterweiterung, die Magistralen auch bis in die neuen Vororte verlängert werden sollten, hatte sich Widerstand geregt. Den Parkgürtel, ihre grüne Lunge, hatten sich die Marßener nicht durch breite Ausfallstraßen verschandeln lassen wollen. Die vier Zubringer, die den Boulevard und den Militärring mit der Autobahn verbanden, waren schon unbeliebt genug. Um die Volksseele zu beruhigen, waren dann zur Verlängerung der Magistralen vier Tunnel gebaut worden, durch deren südlichen Marinos BMW nun rollte. In den Siebzigern hatte man das auch fehlerfrei hingekriegt, sinnierte Delamotte. Nun, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, müsste man für ein derartiges Projekt vermutlich Ingenieure aus der Schweiz oder woher auch immer beauftragen.
„Hast du im Nachgang noch etwas Zeit?“, fragte er.
Marino bejahte; Lissy verbrachte die Ostertage bei ihrer Familie in Franken, und er selber wollte erst am Sonntag seine Eltern in der Nähe von Koblenz besuchen. „Worum geht’s denn?“, wollte er wissen.
„Ich möchte mir da ein paar Orte im Uhu-Fall anschauen“, erklärte Delamotte.
Marino sagte: „Das ist dann aber Arbeitszeit, die ich in diesem Fall nicht mal auf mein Überstundenkonto schreiben kann.“
„Wer weiß“, sagte Delamotte, und erzählte Marino von seinem Gespräch mit Pesch.
„Muss das denn sein“, seufzte Marino, der sich darauf gefreut hatte, nach Abschluss seines aktuellen Falles sein Überstundenkonto etwas abzubauen, und nun vor der Aussicht stand, dem Konto weitere Stunden hinzufügen zu können. Viele weitere Stunden, wie er ahnte, Fälle mit Delamotte waren immer ziemlich zeitintensiv und aufreibend. Andererseits waren sie auch meist recht interessant, und er spürte, dass sein Kumpel heute an den genannten Orten nicht bloß einen Chauffeur, sondern einen Partner brauchte, mit dem er sich austauschen konnte.
„Läuft das gleich auf Gedankentennis raus?“, fragte er und benutzte dabei einen von Delamottes eigenen Begriffen.
Delamotte nickte bekräftigend.
Sie fanden überraschend schnell einen Parkplatz in der Nähe der Neuen Universität. Die Hochschule war in den frühen zwanziger Jahren von der damaligen preußischen Regierung gegründet worden, als moderner, liberaler Gegenpol zu den beiden bereits bestehenden Universitäten der Stadt.
Die alte Universität war noch zu Zeiten der Freien Reichsstadt gegründet und im späten 16. Jahrhundert von den Jesuiten übernommen worden. Auch in der Preußenzeit war die Universität, die sich über mehrere Schulen in der Altstadt verteilte, dem Katholizismus eng verbunden geblieben.
Jenseits des Stroms, in Sievermund, befand sich seit jeher die Grafschafter Universität, gegründet wie der Name bereits verriet durch die Grafen von Altenstein, als eine feste Burg des Luthertums. Die Preußen hatten im 19. Jahrhundert diese Burg recht gerne übernommen und in ihrem Sinne ausgebaut, doch bereits in der Kaiserzeit und erst recht nach Versailles hatte die Grafschafter Universität einen zunehmend deutsch-nationalen Kurs eingeschlagen.
Die westlich der Frankenheide errichtete Neue Universität hatte Marßen also für die neue Zeit bereitmachen sollen. Das um die Hochschule herum entstandene Viertel hatte man Attika genannt, als Zeichen der Ehrerbietung gegenüber der Gelehrsamkeit der Antike. Heutzutage hieß der ganze, überwiegend studentisch geprägte Stadtbezirk so. Delamotte kannte die Gegend nur flüchtig – er hatte an der alten Universität studiert.
Der Laden, den Marino aufgetan hatte, hieß Vinyl Welt und lag in der Ferdinand-Lassalle-Straße. Zu anderen Zeiten tobte hier in Geschäften, Kneipen und Cafés auch tagsüber das studentische Leben, aber nun, am Osterwochenende, war es ziemlich ruhig.
Delamotte blickte sich um; das Geschäft war ziemlich dicht zugestellt mit Tischen, auf denen Schallplatten in großen Boxen standen. Weitere Tonträger hatten ihren Platz in Regalen gefunden, die jedes bisschen Raum an den Wänden einnahmen.
Marino unterhielt sich angeregt mit einer jungen Frau, die offenbar in dem Laden arbeitete. Innerlich seufzte Delamotte: die Dame trug etliche Piercings, ein paar kleine sternförmige Tattoos unterhalb der Augen, und hatte grün gefärbte Haare. Als Kind der Mittelschicht – und Enkel der Arbeiterklasse – war Delamotte diese Art von Selbstinszenierung völlig fremd.
Kurze Zeit später hatte Marino gefunden, was er gesucht hatte. Zusammen gingen sie zur Kasse, wo Delamotte vom Preis für die 2 LPs überrascht wurde.
„Sind ziemlich seltene Pressungen“, erklärte Marino.
Delamotte nickte und erleichterte sein Portemonnaie um 45 Euro.
Auf dem Weg nach Riedenkirchen erläuterte Delamotte seinem Kumpel Marino seine Gedanken bezüglich des Mordes an Dr. Ernsting.
„Du glaubst also, der Arzt ist zufällig zum Opfer geworden?“, fragte Marino.
„Zufällig im Sinne von: spontan“, erklärte Delamotte, „da bin ich mir absolut sicher, ja. Aber auch in diesem Fall muss den Täter etwas motiviert haben – und der geringe zeitliche Abstand zwischen dem Entschluss zur Tat und ihrer Durchführung könnte uns hier einen Schlüssel zum Kopf des Uhus geben.“
Das Haus der Ernstings lag in einer kleinen, verkehrsberuhigten Straße. Von Lüttges hatte Delamotte erfahren, dass Frau Ernsting und die Kinder bei Verwandten in Norddeutschland untergekommen waren. Marino gab die Adresse des Krankenhauses in sein Navi – er wählte die schnellste Route, und würde sich überall genau an das jeweilige Tempolimit halten. Delamotte blickte auf seine Uhr: „Los geht’s.“
Sie kamen fast eine halbe Stunde später am Malteser-Krankenhaus an. Delamotte öffnete einen kleinen Notizblock, den er bereits in Bliesfeld in der Beifahrertür deponiert hatte.
„Das ist interessant“, sagte er, „um 3:13 Uhr hat der Notdienst des Krankenhauses bei Ernsting angerufen, so geht es aus dem Protokoll der Telefonanlage hervor. Das Gespräch dauerte etwas über zwei Minuten.“
„Macht 3:15 Uhr“, warf Marino ein.
„Der Krankenpfleger, der den Toten dann fand, stempelte um 3:40 Uhr für seine Zigarettenpause aus“, ergänzte Delamotte, „das entsprechende Gerät befindet sich direkt neben der Tür, durch die er ins Freie gegangen ist.“
Marino wirkte überrascht: „Gerade mal 25 Minuten, und zu diesem Zeitpunkt ist der Schuss ja bereits gefallen.“
Delamotte erwiderte: „Noch wichtiger ist: Ernsting musste sich zuhause noch anziehen und den Wagen aus der Garage fahren.“
„Das dürfte auch noch mal etwa fünf Minuten gedauert haben“, schätzte Marino. Der Psychologe stimmte zu: „Also maximal zwanzig Minuten für eine Strecke, für die wir gerade gut 29 Minuten gebraucht haben.“
Die beiden Männer stiegen aus, um sich ein wenig die Beine zu vertreten.
„Das macht ja auch durchaus Sinn“, sagte Marino, „Ernsting war auf dem Weg zu einem medizinischen Notfall, natürlich hat er da ordentlich Gas gegeben.“
Delamotte nickte zustimmend: „Und mitten in der Nacht wird ihn auch kaum jemand ausgebremst haben.“
„Auf der Autobahn wohl kaum, aber ein guter Teil der Strecke ist Landstraße“, gab Marino zu bedenken.
„Aber wie wahrscheinlich ist es“, fragte Delamotte, „dass du nachts um drei Uhr irgendwas jemanden überholen musst und dabei auch noch Gegenverkehr hast?“
Das helle Sonnenlicht zwang Marino dazu, die Augen zusammenzukneifen: „Auf jeden Fall hat der Arzt einen ziemlichen Zahn drauf gehabt. Ist es das, was du meintest, als du von der Motivation des Täters sprachst?“
Delamotte wog den Kopf hin und her: „Denkbar auf jeden Fall – etwas anderes fällt mir zumindest nicht ein. Ernsting fuhr einen ziemlich unauffälligen Kombi.“
Marino war nicht überzeugt: „Und der Uhu erschießt ihn, nur weil er ziemlich schnell fährt?“
Delamotte führte den Gedanken weiter: „Nicht alleine deshalb, der Uhu ist eigentlich kein spontaner Typ. In der Nacht könnte zuvor noch was anderes passiert sein.“ Er überlegte einige Zeit: „Und natürlich bewegen wir uns hier auf dem Gebiet der Spekulation.“
Auf der Weiterfahrt gab Delamotte die Erkenntnisse und Überlegungen des Tages telefonisch an Lüttges weiter.
Als er das Gespräch beendet hatte, sagte Marino: „Nehmen wir mal an, unsere Spekulation geht in die richtige Richtung. Auf dem Weg zum Krankenhaus rast Dr. Ernsting am Uhu vorbei. Und der nimmt direkt die Verfolgung auf, warum auch immer. So weit, so gut – aber wo auf dem Weg von Riedenkirchen nach Zievelsburg ist das passiert?“
Delamotte hatte da keine Zweifel: „Auf der Autobahn. Das erscheint mir ziemlich klar. Auf einer Landstraße deutlich schneller als die erlaubten 70 oder 100 zu fahren, erfordert Ortskenntnis und hohes fahrerisches Können. Auf der Eins sind 120 erlaubt, aber dort schneller zu fahren ist keine Kunst und die meisten Autofahrer tun das auch.“
Ein Schuss Grauburgunder ließ die kleine Kasserolle zischen, und Delamotte zog instinktiv seinen Kopf zurück. Er reduzierte die Hitze und widmete seine Aufmerksamkeit der Pfanne auf dem hinteren Kochfeld, in der ein Skreifilet, begleitet von Lauch und Chicorée, sanft in Butterschmalz dünstete. Das Ergebnis seiner bisherigen Arbeit sah gut aus und duftete ebenso gut; Delamotte schob die Pfanne zur Seite – die verbliebene Resthitze würde Fisch und Gemüse noch ein klein wenig weiter garen.
Marino hatte die Einladung zum Abendessen ausgeschlagen. Die Gründe waren, zumindest aus Marinos Sicht, durchaus nachvollziehbar. Er wollte in einer Sportsbar in der Nähe seiner Wohnung das erste Eishockey-Finalspiel zwischen Mannheim und Marßen verfolgen, und es war klar, dass Delamotte auf das Vergnügen dieses Spiels dankend verzichten würde. Der Bliesfelder EV hatte die Playoffs mal wieder verpasst, zum dritten Mal in Serie. Und Delamotte musste sich eingestehen, dass das Versäumen der Playoffs in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren ein bisschen zu regelmäßig passiert war, sogar für eine treue Seele wie ihn. Aber ein Bliesfelder Junge war und blieb nun mal ein Bliesfelder Junge, sogar in Amerika hatte er Anteil am Schicksal seines Vereins genommen, und generell gab es eben Dinge, an denen man tunlichst nichts änderte.
Der Wein in der Kasserolle war inzwischen weitgehend verdampft, Delamotte goss ein wenig stilles Wasser zu Zwiebeln und Knoblauch, und nach einem kurzen Aufkochen rührte er dann die Mischung aus Creme fraiche und Roquefort unter. Ein dezenter Käsegeruch stieg vom Herd auf; Delamotte fügte frisch gemörserten Pfeffer, Lavendel, Majoran und Thymian hinzu. Zehn Minuten lang musste die Sauce jetzt noch auf kleiner Hitze ziehen.
Er goss sich ein Glas von dem sehr überzeugenden Pfälzer Grauburgunder ein und ging ans Fenster. Der leichte Regen hatte bereits eingesetzt, als Delamotte noch beim Einkaufen gewesen war.
Marino hatte ihn am Parkplatz von Schloss Friedrichsruh abgesetzt, nachdem die beiden zuvor einen Blick auf Dorns spektakuläres Anwesen geworfen hatten. Danach waren sie, abermals mit Blick auf die Uhr, die Wege gefahren, die der Uhu und sein Opfer Fischer vor dem zweiten Mord genommen hatten, von der Tankstelle zum Parkplatz respektive zum Nachbarhaus.
Delamotte hatte fast alles, was er für das Osterwochenende brauchte, in den Geschäften am Marktplatz gefunden. Nur mit einem Fischhändler konnte Bliesfeld nicht dienen, was ihn zu einem Umweg über einen am Rand der Altstadt liegenden Supermarkt mit Fischtheke gezwungen hatte. Auf dem Weg vom Supermarkt nachhause war er dann ein wenig nass geworden – aber es war eben April und da musste man mit solchen Umschwüngen rechnen.
Nach dem Essen nahm Delamotte den restlichen Grauburgunder mit ins Arbeitszimmer. Er hatte noch vor dem Kochen einige weitere Gedanken auf Post-its notiert und diese auf das Whiteboard geklebt. Nun blickte er auf das Sammelsurium aus Erkenntnissen, Fragestellungen, Ideen und Vermutungen. Es musste Ordnung in diesen Wirrwarr. Delamotte wandte sich ab und schaute die Weinflasche an: „Bei dieser Aufgabe bist du mir aber keine große Hilfe.“ Er griff sich das Glas, nahm einen Schluck und ließ den Wein langsam über die Zunge in die Kehle laufen. Mit einem leichten Seufzen setzte er sich in den alten, aber sehr bequemen Bürostuhl.
Wären da nur die ersten drei Fälle gewesen, hätte er ein klares Bild vom Uhu gehabt – planvoll, abgeklärt, vorsichtig. Aber dann war da der Mord an Dr. Ernsting – ungeplant, spontan, impulsiv, auf fast schon obszöne Weise zufällig. Wie ein plötzliches Unwetter, eine Lawine, ein Vulkanausbruch. War der Uhu so etwas wie ein Vulkan, der unter einer vermeintlich ruhigen Oberfläche brodelte, um dann unerwartet auszubrechen? Aber das passte nicht zu den anderen Fällen.
Oder konnte es vielleicht doch passen? Delamotte musste davon ausgehen, dass der Uhu Dr. Ernsting spontan, einem Impuls folgend getötet hatte. Was sagte das über den Täter, was über seinen Charakter? Hatte dieser Mann, der meist ruhig und zielgerichtet agierte, eine Disposition für plötzliche Ausbrüche? Nicht unbedingt tödlicher Natur – aber schon solche Ausbrüche, die von seiner Umwelt bemerkt wurden, und die zu Reaktionen seiner Umwelt führten. Hatte der Uhu vielleicht genau solche Situationen erlebt, bevor er den jeweils nächsten Schritt in seiner mörderischen Karriere machte?
Überfordern dich Emotionen? Weil sie unter deiner ruhigen Oberfläche brodeln, und du darum kämpfst, sie nicht rauszulassen?
In einer Dokumentation, auf einem der vielen kleinen Kabelsender, hatte Delamotte einmal gesehen, wie jemand am Rand eines Vulkans eine Flasche Wasser in eine Erdspalte geschüttet hatte. Eine Zeitlang war nichts passiert; aber dann war das Wasser in einer kräftigen Eruption nach oben geschossen, wie ein Mensch gemachter Geysir. Wie und wann kam das Wasser unter die Oberfläche des bösen Mannes, den Delamotte fangen wollte?
Das Osterlamm war so perfekt wie immer, das Fleisch butterzart, die Kräuternote anregend aber nicht aufdringlich, und das Wurzelgemüse hatte das Lammaroma übernommen, ohne den eigenen Geschmack zu verlieren.
„Es schmeckt fantastisch“, sagte er in Richtung seiner Mutter, und vernahm von den anderen Gästen zustimmendes Gemurmel.
Nach dem Frühstück hatte er seinen Großvater zur Ostermesse abgeholt. In St. Clemens hatten sie seine Eltern getroffen – seine Schwester Katharina, deren Bezug zur Religion schon vor langer Zeit verloren gegangen war, hatte wie gewohnt vor der Kirche auf die anderen gewartet. Sein Bruder Hardy, eigentlich Gerhard-Paul, verbrachte die Ostertage in Berlin, wo er im wissenschaftlichen Dienst des Bundestags beschäftigt war.
„Der Hardy ist leider unabkömmlich, er muss wichtige Unterlagen für die nächste Sitzungswoche vorbereiten, und wünscht euch allen frohe Ostern“, hatte Delamottes Mutter erklärt. Kata und er hatten vielsagende Blicke ausgetauscht – jeder wusste, dass Hardy nicht gerade schöne Erinnerungen an seine Jugendzeit in Bliesfeld hatte. Aber es gab eben Dinge, über die man nicht so offen sprach.
In der Brusttasche von Delamottes Hemd vibrierte das Handy. Er entschuldigte sich bei den anderen und verließ das Esszimmer. Lüttges war am Apparat und bestätigte noch einmal die Zeitangaben aus der Nacht zum Gründonnerstag. Die Diskrepanz zwischen der aus den Zahlen abgeleiteten Fahrzeit des Arztes und jener von Marinos Feldversuch hatte den Kommissar zum Rechner greifen lassen: „Selbst wenn Dr. Ernsting auf der Landstraße und in den innerörtlichen Passagen seines Weges ein Stück weit schneller gefahren ist als erlaubt – und da schränkt ja schon die Straßenführung das Tempo ein – dann muss er auf der Autobahn um die 200 Sachen drauf gehabt haben, um die Strecke zum Krankenhaus so schnell zu schaffen. Ich habe es durchgerechnet.“ Delamotte war beeindruckt. „Das hat mich auf eine Idee gebracht“, fuhr Lüttges fort. „Sind die früheren Opfer vielleicht durch zu schnelles Fahren oder andere Regelverstöße aufgefallen? In dem Fall sollten sie bei der Verkehrspolizei keine Unbekannten sein.“
Am frühen Nachmittag verließ Delamotte das Haus in der Wiesenau. Seine Mutter drückte ihm noch ein Schälchen mit Lamm und Gemüse in die Hand, und Katharina, die den Großvater nachhause bringen würde, begleitet ihren Bruder nach draußen.
„Als ich letzten März mit Harald Schluss gemacht habe, hätte ich nicht gedacht, dass du und Sonja noch im gleichen Jahr auseinandergehen würdet“, sagte sie.
Ähnlich wie ihre Mutter hatte sie damit gerechnet, dass ihr Bruder und seine Partnerin irgendwann heiraten und für die nächste Generation Bliesfelder Delamottes sorgen würden. Auf die eigene Person bezogen hatte sie da Zweifel, von Hardy ganz zu schweigen.
Katharina drückte Delamottes Arm: „Das Aus geht dir ziemlich nahe, stimmt’s?“
Er nickte: „Natürlich tut es das – fünf Jahre sind eine verdammt lange Zeit, der Tapetenwechsel wird mir helfen, denke ich.“
Seine Schwester kniff die Augen leicht zusammen: „Ein beruflicher Wechsel vielleicht auch, was meinst du? Ich meine, du bist ja nicht vom Polizeidienst abhängig – auch bei uns in der Industrie arbeiten Psychologen.“
Delamotte lächelte versonnen – nach Ali war seine Schwester nun schon die zweite Person, die ihm einen anderen Weg aufzeigte als den, den er eingeschlagen hatte.
Das Arbeitszimmer war vergleichsweise dunkel, neben dem Laptop sorgte nur eine Stehlampe in der Ecke für etwas Licht. Delamotte blickte konzentriert auf den Monitor – den Nachmittag und frühen Abend hatte er genutzt, die ihm bekannten Fakten und seine Vermutungen und Intuitionen bezüglich des Uhu zu sortieren. Zwischendurch hatte er rasch die Reste des Mittagessens aufgewärmt und stehend am Herd gegessen. Zu diesem Zeitpunkt konnte er eine längere Unterbrechung seines Gedankenstroms nicht gebrauchen.
Doch nun stand das Grundgerüst des Profils ziemlich stabil vor seinen Augen. Delamotte hatte ein relativ klares Bild des Mannes gewonnen, den sie möglichst rasch aus dem Verkehr ziehen mussten. Das ungefähre Alter, die groben Lebensumstände, der Charakter – er hatte das Gefühl, den Uhu in den letzten Stunden etwas besser kennengelernt zu haben. Abermals überflog er die einzelnen Punkte auf dem Monitor, der sein Gesicht in ein etwas ungesund wirkendes Licht tauchte. Doch, das hatte alles Sinn, dachte Delamotte zufrieden. Er musste das Profil jetzt nur noch in eine lesbare Reinform bringen – Delamotte erhob sich aus dem Bürostuhl und ging ins Wohnzimmer. Auf dem Tisch stand zur Belohnung eine Flasche Cru bourgeois.
Er hatte sich gerade, im Wohnzimmer auf und ab gehend, ein zweites Glas nachgeschenkt, als die Klingel seinen Gedankenstrom unterbrach. Diesmal stand in der Tat Britta Kowallik vor der Tür. „Störe ich, oder kann ich reinkommen?“, fragte sie mit einem entwaffnenden Lächeln.
Ein wenig überrumpelt machte er ihr Platz und geleitete sie ins Wohnzimmer. „Was ist mit deinem Sohn?“, fragte er, während Britta es sich auf dem Sofa bequem machte.
Sie erklärte: „Timmy ist über Ostern bei seinem Papa. Ich selber bin gerade von einem Besuch bei meinen Eltern im Taunus zurückgekommen.“
Delamotte holte ein Glas aus dem Schrank: „Magst du auch einen Wein?“
„Ich trinke ja eher Bier“, antwortete Britta, „aber Wein ist auch OK.“
Delamotte überlegte: „Ich glaube, ich habe noch etwas Bier im Keller.“
„Nein, lass mal gut sein“, winkte Britta ab, „Wein ist absolut OK.“
Er füllte das Glas, reichte es Britta und setzte sich in seinen Sessel. „Nun denn, frohe Ostern“, sagte er und hob sein Glas.
Britta lachte halblaut: „Stimmt, frohe Ostern – Christus ist auferstanden, sagen die Orthodoxen an diesem Tag.“
Delamotte war verblüfft, und offenbar war ihm das anzusehen.
Seine Nachbarin erklärte: „Mein Ex ist aus Montenegro – das färbt halt ab.“ Sie nahm einen Schluck und nickte anerkennend: „Der ist gut. Franzose?“
„Aus Bordeaux, ganz genau genommen Saint-Estèphe“, bestätigte er. Dann fragte er vorsichtig: „Ihr seid geschieden, du und dein Ex?“
„Im Trennungsjahr“, erwiderte sie, „offiziell seit August. Innerlich eigentlich schon viel länger.“ Britta wählte achtsam die Worte: „Es hatte sich schon seit über einem Jahr angedeutet, mit der Zeit fühlte sich das Leben immer weniger richtig an.“ Sie seufzte: „Nun gut, Radi und ich, wir versuchen die Scheidung gesittet über die Bühne zu bringen. Vor allem so, dass es für Timmy möglichst leichter wird. Und Gott sei Dank hatten wir noch nicht gebaut.“
Ihr Blick traf seinen, als sie fragte: „Und, wie sieht es bei dir aus? Irgendwelche frischen Wunden, oder alles schon vernarbt?“
Delamotte neigte mit etwas bitterlichem Lächeln den Kopf: „Vernarbt ist da noch gar nichts, um ehrlich zu sein.“ Britta schaute ihn verständnisvoll an, während er fortfuhr: „Ein Trennungsjahr brauchen wir nicht. Und leichter machen müssen wir es auch niemandem – am allerwenigsten uns selbst.“
Delamotte hatte sich in den letzten Tagen kaum noch mit dem Ende der Beziehung auseinander gesetzt. Obwohl die Erinnerung schmerzhaft war, tat es gut, sich mit jemandem zu unterhalten, dessen Horizont ähnlich war.
„Und was hat dich ausgerechnet nach Bliesfeld geführt?“, wollte Britta wissen.
„Ich bin hier großgeworden“, erklärte er, „Bliesfelder Junge durch und durch. Das hier ist quasi mein natürlicher Fluchtpunkt. Der Schlosspark, der Marktplatz, der Vossemer Wall.“
Verblüfft registrierte er, dass Britta grinsend die Melodie von „Bleesfelder Jonge“ summte. Sie bemerkte seinen Blick und lachte: „Guck nicht so – ich habe dir doch schon mal erzählt, wir sind Anfang des Jahres hier eingezogen. Knapp zwei Wochen vor dem Derby. Und draußen war immer dieses eine Lied zu hören – aus den Kneipen, im Supermarkt, wirklich überall …“
„Und du hast nicht gleich Reißaus genommen?“, fragte Delamotte, nun ebenfalls lachend.
„I wo“, schüttelte Britta den Kopf, „ich hatte ja gute Gründe, nach Bliesfeld zu ziehen.“
Das machte ihn neugierig: „Und die wären?“
Er führte das Weinglas zum Mund, als Britta grinsend antwortete: „Die Kindergärten.“
„Was?“ – Beinahe hätte er sich verschluckt.
Brittas helles Lachen erfüllte das Wohnzimmer. Sie erklärte: „Bliesfeld hat von allen Stadtbezirken die fünfthöchste Dichte an Kindergartenplätzen, bezogen auf die Einwohnerzahl. Na ja, streng genommen die sechsthöchste, Schwabstadt sticht absolut heraus, aber das sind zumeist Betriebskindergärten der Suebia-Werke. Für Werksfremde kaum eine Chance.“ Britta nahm einen Schluck Wein und fuhr fort: „Die anderen – also vor Bliesfeld – waren Reven, Königshafen, Uelem und Vernay. Letzteres ungefähr gleichauf mit Bliesfeld. Königshafen ist natürlich viel zu teuer, Reven ist mir zu hip, und Uelem? Die Hälfte der Kindergärten liegen am Antoniusberg – mehr muss ich nicht sagen, oder?“
Delamotte konnte sie gut verstehen: „Und was sprach gegen Vernay?“ Er selber kannte das alte Landstädtchen im äußersten Westen der Stadt nur dem Namen nach, durch das berühmte frühere Zisterzienser-Kloster.
„Gar nichts“, sagte Britta, „aber in Bliesfeld war schneller eine passende Wohnung frei.“
Das Gespräch mit seiner Nachbarin tat Delamotte zunehmend gut, und er beschloss, Arbeit Arbeit sein zu lassen. Das Profil konnte er auch noch am Montagvormittag ins Reine schreiben. Die Flasche Phélan Ségur war inzwischen fast leer – er teilte den Rest auf die beiden Gläser auf und sagte: „Wenn es dich nicht stört, hole ich noch ein Fläschchen aus dem Keller.“
Britta Kowallik blickte ihn erstaunt an: „Willst du damit sagen, du hast einen Weinkeller hier?“
Delamotte grinste verlegen: „Also, sag’s nicht weiter, aber… Ja, also irgendwie schon.“
Britta erhob sich vom Sofa: „Dann komme ich mit, das will ich sehen.“
Schweigend fuhren die beiden mit dem Aufzug nach unten. Als er die Tür zu seinem Kellerraum öffnete, weiteten sich Brittas Augen: „Donnerwetter!“
Delamotte griemelte; er war ganz froh darüber gewesen, dass Sonja bei der Trennung keinen Anteil am Wein verlangt hatte. Das hätte ihr durchaus zugestanden – vielleicht nicht unbedingt die Hälfte, und garantiert nicht die alten Schätzchen, die ihm seine Eltern zum Diplom geschenkt hatten. Aber Sonja hatte gar nichts gefordert, und so lagerten hier, im Keller eines typischen Mietshauses aus den 70er Jahren, fast 600 Flaschen Wein aus den unterschiedlichsten Ländern und Anbaugebieten. Friedlich vereint mit einigen Sixpacks diverser belgischer Biere, und einem kleinen Regal voll Spirituosen.
Delamotte blickte Britta ins Gesicht: „Was ist dir genehm? Noch einen Roten oder lieber einen Weißen.“
Sie überlegte nur kurz: „Ich glaube, zur Abwechslung mal einen Weißen.“
„Dann bleiben wir aber in Frankreich“, sagte er und ergriff einen Chenin Blanc von der Loire.
Der Ring - Fortsetzungsroman, Teil 5
-
Unter dem Schreibtisch in Delamottes Arbeitszimmer ratterte der schon etwas altersschwache Drucker.…
-
18 Jan 2024
Der Ring - Fortsetzungsroman, Teil 3
-
Mehr als nur seltsam kam Kommissar Manfred Lüttges die Wahl des Ortes vor, an dem Delamotte seinen H…
-
16 Jan 2024
See all articles...
Authorizations, license
-
Visible by: Everyone (public). -
All rights reserved
-
35 visits
Jump to top
RSS feed- Latest comments - Subscribe to the feed of comments related to this post
- ipernity © 2007-2024
- Help & Contact
|
Club news
|
About ipernity
|
History |
ipernity Club & Prices |
Guide of good conduct
Donate | Group guidelines | Privacy policy | Terms of use | Statutes | In memoria -
Facebook
Twitter
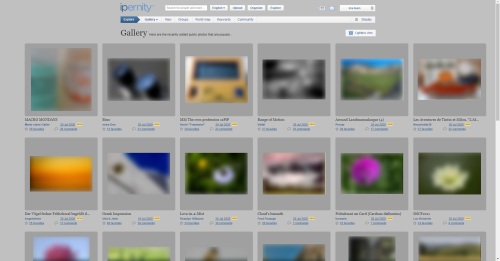
Sign-in to write a comment.